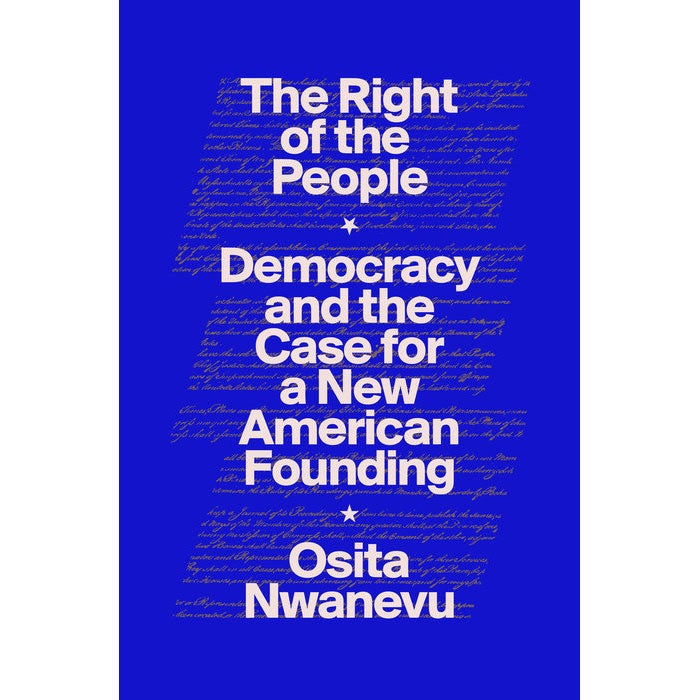Der beste Weg, den Senat zu reparieren? Ihn abschaffen.

 (Mindestbreite: 1024px)709px,
(Mindestbreite: 768px)620px,
calc(100vw - 30px)" width="1560">
(Mindestbreite: 1024px)709px,
(Mindestbreite: 768px)620px,
calc(100vw - 30px)" width="1560">Melden Sie sich für „Slatest“ an , um täglich die aufschlussreichsten Analysen, Kritiken und Ratschläge in Ihren Posteingang zu erhalten.
In einem wichtigen Punkt ist der moderne Senat demokratischer als die gesetzgebenden Oberhäuser mancher vergleichbarer Staaten. In Frankreich und Deutschland werden die Mitglieder des Oberhauses immer noch von anderen gewählten Amtsträgern und nicht vom Volk gewählt – genau wie die amerikanischen Senatoren vor dem 17. Verfassungszusatz im Jahr 1913. Dennoch ist unser Senat in fast jeder anderen demokratischen Hinsicht eines der schlechtesten beratenden Gremien der Welt.
Die gravierendsten Mängel des Senats liegen in seiner Grundstruktur begründet. Doch wie beim Repräsentantenhaus spielen auch die Regeln und Verfahren, die sich der Senat gegeben hat, eine Rolle. Eine besonders wichtige Regel hat in den letzten Jahren erneut Aufmerksamkeit erregt. Obwohl der Senat vorgeblich nach dem Mehrheitsprinzip regiert, bedarf es einer qualifizierten Mehrheit – seit 1975 drei Fünftel der Kammer, also 60 Senatoren –, um Debatten zu beenden. Praktisch bedeutet das, dass ein Gesetzesentwurf in der Schwebe gehalten werden kann, wenn nicht 60 Senatoren ihn ausreichend unterstützen, um die Debatte zu beenden und zur Abstimmung zu bringen. Ohne diese qualifizierte Mehrheit kann die Minderheit, die gegen einen Gesetzesentwurf ist, die Debatten am Laufen halten, um ihre Unterstützer zu zermürben – eine Taktik, die als Filibuster bekannt ist. Die bloße Drohung eines Filibusters reicht heute aus, um Gesetze ohne 60 Stimmen zu torpedieren – eine Situation, die bedeutet, dass die meisten Gesetzesentwürfe ohne eine qualifizierte Mehrheit im Senat nicht durch den Kongress kommen.
Abgesehen vom kontramajoritären Charakter des Filibusters ist der Senat von Natur aus ungleich verteilt, da die Senatoren aller Bundesstaaten unabhängig von ihrer Bevölkerungszahl gleich stark vertreten sind – ein Merkmal, das Gründerväter wie James Madison und Alexander Hamilton lautstark bekämpften, bevor die kleinen Bundesstaaten auf dem Verfassungskonvent einen Kompromiss erzwangen. Die Ungleichheiten, die die paritätische Vertretung für sie zu einer so bitteren Pille machten, haben sich seit der Verfassungsgebung nur noch vertieft. Theoretisch können Bundesstaaten, die weniger als 20 Prozent der Landesbevölkerung ausmachen, eine Senatsmehrheit haben, während Bundesstaaten mit nur 11 Prozent der Bevölkerung Gesetze durch den Filibuster blockieren können. Im Jahr 1787 hatte Virginia, damals der größte Bundesstaat, eine 12- bis 13-mal größere Bevölkerung als Delaware, der kleinste Bundesstaat, der so viel getan hatte, um die paritätische Vertretung auf dem Konvent durchzusetzen. Doch unser heute größter Bundesstaat, Kalifornien – der allein zu den 40 größten Ländern der Welt gehören würde – hat eine mehr als 67-mal größere Bevölkerung als unser kleinster Bundesstaat, Wyoming. Da beide gleich viele Sitze im Senat haben, ist jeder Einwohner Wyomings rechnerisch 67-mal stärker in der Kammer vertreten als jeder Einwohner Kaliforniens.
Die am leichtesten durchzusetzenden Reformen im Senat wären Änderungen der Geschäftsordnung – die allerdings nicht in Stein gemeißelt ist. Die Mehrheitspartei kann für grundlegende Änderungen der Vorgehensweise stimmen, vorausgesetzt, sie kann sich auf diese Änderungen einigen. In den letzten Jahren haben sich die Demokraten in Bezug auf die Filibuster-Taktik im Parlament so etwas wie einen Konsens erarbeitet. Diese wurde für Ernennungen in Exekutive und Judikative bereits abgeschafft; jeder vom Präsidenten nominierte Abgeordnete kann mit einfacher Mehrheit der Kammer bestätigt werden. Die Filibuster-Taktik bleibt jedoch für alle Gesetzesvorhaben bestehen, die nicht durch das für Haushaltsfragen vorgesehene Verfahren zur Haushaltsabstimmung durchgebracht werden können.
Ein Vorschlag, der vom ehemaligen Präsidenten Joe Biden und vorsichtigen Reformern unterstützt wird, ist die Rückkehr zum Filibuster. Wer Gesetze blockieren will, müsste dann wie früher stundenlang im Senat stehen und reden. Doch das wäre keine demokratische Reform. Der Filibuster bliebe bestehen und würde seine Absurdität sogar noch vertiefen.
Anstatt körperliche Ausdauertests in den politischen Entscheidungsprozess einzuführen, schlugen andere Reformer schlüssiger vor, den Filibuster mehrheitsorientierter zu gestalten – etwa indem man vorschrieb, dass Gesetzesentwürfe, die im Repräsentantenhaus mit einer Zweidrittelmehrheit unterstützt werden, im Senat mit einfacher Mehrheit verabschiedet werden können, oder dass nur Senatoren, die die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren, den Filibuster anwenden dürfen. Insbesondere letztere Idee wäre eine klare demokratische Verbesserung gegenüber dem Status quo. Dasselbe würde natürlich auch die gänzliche Abschaffung des Filibusters bedeuten.
Dennoch wird eine Reform oder Abschaffung des Filibusters die grundlegenden Ungerechtigkeiten im Senat nicht beheben – die gleiche Verteilung der Senatoren auf alle Bundesstaaten, die keine Rücksicht auf die Bevölkerungszahl nimmt, ist demokratisch unhaltbar. Die gleiche Beteiligung am Senat ist leider einer der wenigen Teile der Verfassung, die grundsätzlich unveränderlich sind: Gemäß Artikel 5 erfordert eine Änderung dieses Aspekts der Grundstruktur der Kammer offenbar die einstimmige Zustimmung aller Bundesstaaten. Einige Reformer argumentieren, dieses Verbot könne ignoriert oder irgendwie umgangen werden – vielleicht könnten wir einen Verfassungszusatz verabschieden, der die Klausel streicht, die besagt, dass der Senat nicht geändert werden kann, und dann den Senat mit einem weiteren Verfassungszusatz ändern.
Welche alternativen Entwürfe für den Senat könnten wir in Betracht ziehen, vorausgesetzt, dass Änderungen möglich wären? Die naheliegendste Änderung wäre natürlich, die Senatoren proportional zur Bevölkerung jedes Bundesstaates zu verteilen. Einige Reformer argumentieren jedoch, dass wir die Notwendigkeit eines ermächtigten Oberhauses längst überwunden hätten und schlagen vor, den Senat durch eine Gesetzesänderung in ein überwiegend zeremonielles Gremium umzuwandeln, ähnlich dem britischen House of Lords, das selbst schrittweise zugunsten des House of Commons entmachtet wurde. 2018 unterstützte der Kongressabgeordnete John Dingell aus Michigan, das dienstälteste Kongressmitglied in der amerikanischen Geschichte, eine viel einfachere Idee: Der Senat, so argumentierte er, sollte schlicht abgeschafft werden.
Schließlich ist es nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt ein Zweikammersystem brauchen. Etwa zwei Drittel aller Länder weltweit verfügen nur über ein einziges Parlament – abgesehen von Ländern mit einem Zweikammersystem wie Großbritannien, wo fast die gesamte tatsächliche Gesetzgebungsgewalt in einem einzigen Haus liegt.
Föderalismus – die Idee, dass die Interessen der Bundesstaaten als Ganzes in der Legislative so vertreten sein sollten, als wären sie selbst Bürger – ist kein überzeugendes demokratisches Argument, insbesondere in einem Land wie unserem, in dem die Bundesstaaten bereits so viel unabhängige Macht haben, dass ihre Regierungen die Ziele der Bundesregierung oft vereiteln. Und wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, dass die Entscheidungen der vom Volk gewählten Vertreter in einer großen, bevölkerungsbasierten Kammer wie dem Repräsentantenhaus von einem kleineren, langsameren Gremium elitärer Politiker kontrolliert werden sollten. Wenn wir unbedingt zwei Kammern haben wollen, könnten wir sogar erwägen, eine von ihnen noch direkter zu gestalten als das Repräsentantenhaus – vielleicht, wie Theoretiker wie Tom Malleson argumentieren, indem man sie zu einer beratenden Versammlung einfacher, durch das Los bestimmter Bürger macht:
Stellen Sie sich ein Volkshaus vor, das aus, sagen wir, tausend zufällig ausgewählten Menschen besteht (und in Schichten aufgeteilt wird, um eine genaue Vertretung nach Geschlecht, Rasse, Klasse und anderen wichtigen Kriterien zu gewährleisten). Diese Mitglieder könnten eine Amtszeit von vier Jahren absolvieren. In den ersten beiden Jahren hätten sie keine gesetzgebende Gewalt und würden in dieser Zeit eine umfassende Ausbildung in Haushalts-, Steuer- und Verteilungsgerechtigkeitsfragen erhalten. Sie würden die verschiedenen Bereiche der Regierung kennenlernen, Kurse in rationalem, einfühlsamem und gemeinwohlorientiertem Denken absolvieren und ein „Praktikum“ in einer bestimmten Politikabteilung absolvieren, etwa für Gesundheit, Energie oder Umwelt. In der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit hätten die Mitglieder gesetzgebende Gewalt, vielleicht aufgeteilt in zehn Abteilungen mit jeweils einhundert Mitgliedern. Jede Abteilung würde über Fragen in ihrem Zuständigkeitsbereich beraten (ähnlich wie die Bürgerversammlungen), bevor sie Gesetzesvorschläge einreicht, über die das gesamte Gremium abstimmt und die in Kraft treten.
Deliberative Experimente in Kanada, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Belgien, den Niederlanden und sogar hier in Amerika haben gezeigt, dass normale Bürger durchaus in der Lage sind, in versammlungsähnlichen Umgebungen produktiv untereinander zu debattieren und sich mit Experten zu politischen Fragen zu beraten. Das Problem bei solchen Systemen liegt weniger in der Kompetenz der Bürger als in der geringen Teilnehmerzahl. Wenn wir Entscheidungsfreiheit als demokratisches Anliegen ernst nehmen, ist es demokratisch problematisch, eine zufällig ausgewählte, selbst demografisch repräsentative Untergruppe der Öffentlichkeit für die Öffentlichkeit entscheiden zu lassen, anstatt die gesamte Öffentlichkeit selbst entscheiden zu lassen. Angesichts all der Faktoren, die die Entscheidungsfindung von Gruppen beeinflussen können – individuelle Persönlichkeiten, Temperamente und Stimmungen, Unterschiede in Schreib- und Sprechfähigkeiten usw. –, ist es wenig sinnvoll anzunehmen, dass eine zufällig ausgewählte Versammlung von Einzelpersonen genauso beraten oder handeln würde wie jede andere zufällig ausgewählte Gruppe von Menschen oder die breite Öffentlichkeit. Doch so etwas wie ein Volkshaus könnte als eine Art Beratungsgremium durchaus nützlich sein – eine Möglichkeit, unsere Abgeordneten und Politiker in regelmäßigen Kontakt mit einem Querschnitt der amerikanischen Bevölkerung zu bringen und einen Pool von Personen zu schaffen, die von der Presse zu den dem Parlament vorliegenden Angelegenheiten auf informative Weise befragt und konsultiert werden könnten.
Unabhängig davon, ob wir uns für eine solche Idee entscheiden oder nicht, sollten wir ambitioniert darüber nachdenken, wie eine demokratischere Legislative aussehen könnte. Welche Form unsere nächste auch annehmen mag, sie sollte auf keinen Fall dem Kongress ähneln, wie wir ihn kennen.
Dieser Artikel ist eine Adaption des Buches „The Right of the People“ von Osita Nwanevu. Copyright © 2025 beim Autor und Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Penguin Random House.
 Melden Sie sich für den Abend-Newsletter von Slate an.
Melden Sie sich für den Abend-Newsletter von Slate an.