Pedro und die dichte Stille der Fische
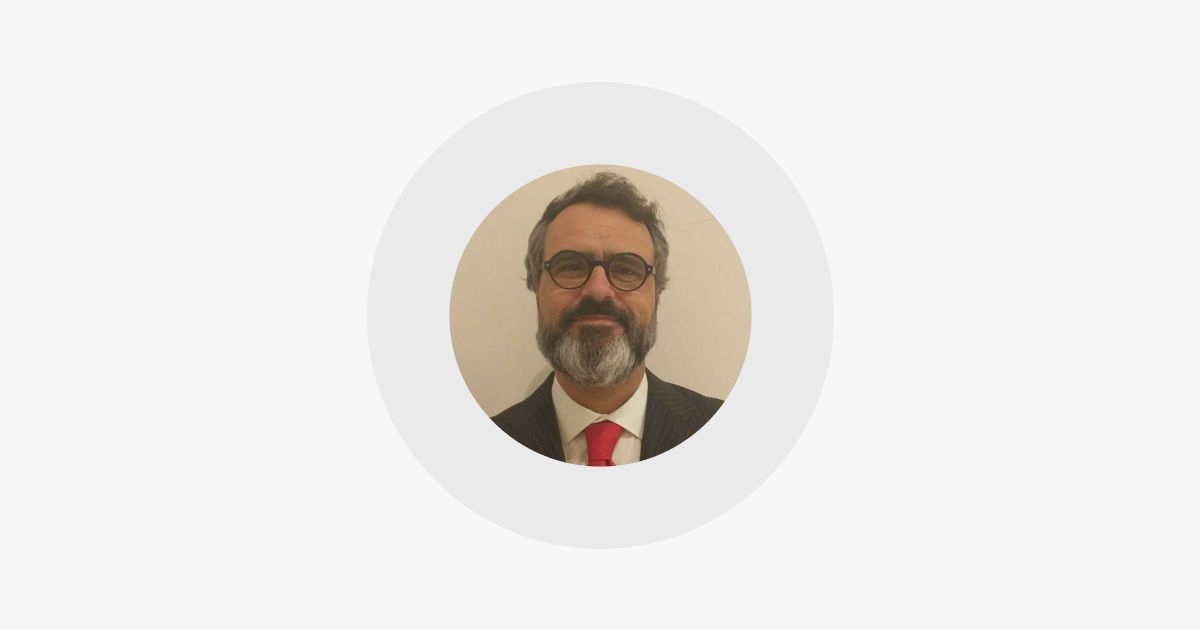
Sein Name war Simon, der Sohn und Enkel von Fischern aus Bethsaida. Er selbst war Fischer in Kapernaum. Dieses schöne portugiesische Wort – das heute „Lagerhaus“ und „Chaos“ bedeutet – war damals der Name eines Dorfes. Ein besonders anthropomorpher Gott näherte sich dem Boot, begrüßte den Fischer und forderte ihn auf, diesen Namen loszuwerden und ihn durch ein selbstgewähltes Patronym zu ersetzen. Er befahl ihm, den See Genezareth zu verlassen. Er befahl ihm, die Bucht zu verlassen. Er befahl ihm, die Netze loszulassen. Er gab ihm einen Namen – Pedro.
Die Geschwindigkeit und Fremdartigkeit dieser Taufe begannen die akustische Umgebung, in die Simão bis dahin eingetaucht war, zu trüben und zu stören. Diese neuen Silben, auf deren Laute er fortan reagieren musste, das Verdrängen und Begraben der alten Silben, die ihm seinen Namen gegeben hatten, das Unterdrücken der Gefühle und das Aufgeben der kleinen Fabeln, die sich im Laufe seiner Kindheit nach und nach mit diesen Lauten verbunden hatten, verrieten sich manchmal durch gewisse unfreiwillige und unerwartete Verhaltensweisen: das Bellen eines Hundes, das Zerbrechen von Geschirr, das Steigen des Meeres, der Gesang einer Drossel, einer Nachtigall oder einer Schwalbe ließen ihn plötzlich in Tränen ausbrechen.
Laut Cneius Mammeius vertraute Petrus Judas einst an, dass das Einzige, was er an seiner früheren Beschäftigung bedauerte, nicht das Boot, die Bucht, das Wasser, die Netze, der intensive Geruch oder das Licht war, das in den Schuppen der Fische gefangen bleibt, wenn sie bei einem solchen Schock sterben: Petrus gestand, dass das, was er an den Fischen vermisste, die Stille war. Die Stille der Fische, wenn sie sterben, die Stille am Tag, die Stille in der Dämmerung, die Stille während der Nachtarbeit, die Stille im Morgengrauen, wenn das Boot zum Strand zurückkehrt und die Nacht langsam vom Himmel verschwindet, zusammen mit der Frische, den Sternen und der Angst.
Eines Nachts Anfang April des Jahres 30 war es in Jerusalem im Hof des Hohepriesters Annas, des Schwiegervaters von Kaiphas, sehr kalt. Diener und Wachen saßen im Kreis. Sie streckten ihre Hände zum Feuer aus. Pedro sitzt zwischen ihnen und reibt sich ebenfalls die Hände in der Nähe des Kohlenbeckens, um seinen zitternden Körper zu wärmen. Eine Frau nähert sich. Er glaubt, seine Gesichtszüge im glühenden Schein der Flammen wiederzuerkennen. Im Atrium bricht der Tag im spätwinterlichen, feuchten Nebel an. Plötzlich kräht ein Hahn. Petrus zuckt bei dem Geräusch zusammen, was ihm sofort etwas enthüllt, was Jesus von Nazareth zu ihm gesagt hatte – oder zumindest etwas, an das sich Petrus plötzlich erinnerte. Er entfernt sich vom Feuer, von der Frau, von den Wachen, erreicht den Säulengang des Hofes des Hohepriesters und bricht an der Tür unter dem Gewölbe in Tränen aus. Es sind bittere Tränen. Tränen, die der Evangelist Matthäus als bitter bezeichnet.
„Ich weiß nicht, was Sie sagen“, sagt Pedro zu der Frau im Flur. Wiederholen Sie: Nescio quid dicis (Ich weiß nicht, was Sie sagen). Die Frau zieht in der eiskalten Aprilnacht ihre Kapuze zurück. Dort heißt es: „Deine Worte verraten dich.“ ( Tua loquela manifestum te facit .) Ich weiß nicht, was die Worte manifestieren, wiederholt er. Es sind deine Tränen. Ich wiederhole: Das ist mein Leben. Ich weiß nicht, was du gesagt hast . Ich weiß nicht, was Sie sagen. Ich weiß nicht, was ich sage, aber es ist alles klar.
Ich weiß nicht, was Sie sagen, aber der Tag bricht an. Ich weiß nicht, was die Zunge kundtut, aber zum zweiten Mal beginnt der Hahn das heisere und schreckliche Lied anzustimmen, das den Tag verkündet. Die Natur bellt im Morgengrauen in Form eines Hahns: latrans gallus . Unter dem Portikus, in dem, was von der Nacht übrig bleibt, flevit amare . Er weinte bitterlich. Amare , ein Verb mit der Bedeutung „lieben“, kann auch ein Adverb mit der Bedeutung „bitter“ sein. Während er spricht, weiß niemand, was er sagt.
Jorge Luis Borges zitierte einen Vers, den Boileau aus Vergil übersetzt hatte: le moment où je parle est déjà loin de moi . Tatsächlich ist es dieser Vers von Horaz, der dem Carpe Diem der Ode XI vorausgeht – dum loquimur, fugerit invidia aetas – und darin beschwört Borges den Fluss herauf, der sich in Heraklits Augen spiegelt, als er ihn überquert. Die Augen des Mannes veränderten sich weniger als das Wasser, das vorbeifließt. Sie sind beide gleichermaßen schmutzig. Niemand sieht den Fluss, in dem er gebadet hat, bevor es ihn gab.
Bei Lukas wirkt die Szene der Verleugnung zwangsläufig griechischer als bei den anderen Evangelisten: Ein Kreis von Wächtern und Dienern sitzt mitten im Hof um das Feuer herum. Petrus versucht, in den Kreis einzutreten, der an Szenen aus der Ilias erinnert, und versucht, seinen Körper in der engen Solidarität der Menschen zu wärmen, mehr als in der Hitze, die im Aprilmorgen des Jahres 30 vom Kohlenbecken aufsteigt. Doch Lukas geht noch ein wenig weiter: Er verbindet die beiden Szenen, die der Verleugnung und die der Tränen. Er stapelt sie übereinander wie zwei Sedimente in derselben geologischen Schicht: Et continuo adhuc illo loquente cantavit gallus (Und in diesem Moment, während er noch sprach, krähte ein Hahn.)
Von einem Loquimur … Das Krähen des Hahns ist ein „Stolperstein“ im Herzen der akustischen Spracherfahrung, über den Pedro stolpert, wie auch über seinen Namen. Das raue Lied, das die Morgendämmerung ankündigt, versetzt ihn auf eine andere Ebene seiner selbst: die Ebene von Jesus, die Ebene von Petrus, die Ebene vor Petrus (die Ebene von Simon), die Ebene vor Simon. „Nicht nur Ihr Gesicht, Ihre Gesichtszüge oder Ihr Körper verraten Sie“, sagte der Diener, „sondern auch Ihre Sprache verrät Sie.“ Der griechische Text lautet: „Deine Lalia macht dich sichtbar.“ Der lateinische Text lautet: „Deine Rede macht dich offenbar.“
In der Akustik, die ihn verrät, tiefer als der Name, den er verrät (Jesus), tiefer als der Name, den er verraten hat (Simon), liegt der kleine Teil der Akustik, den die Sprache kultiviert, der sich plötzlich auf das gewaltige Bellen der Natur und den schmalsten Abschnitt des Tiergesangs bezieht, aus dem die menschliche Sprache ihr kleines Gefäß mit besonderen Klängen geschöpft hat.
In den Ohren des Dieners verrät die Sprache Petrus auf mindestens drei verschiedene Weisen: durch den Akzent, durch die typisch galiläischen Gesichtszüge, durch die Veränderung der Stimme aufgrund der Angst, die Petrus angesichts der an ihn gerichteten Fragen empfindet. Pedros Angst, eingefangen durch das Krähen des Hahns, stellt einen harten akustischen Schock dar, der einen Fisch in sein Netz fängt, der älter ist als der Fischer selbst, ein Gesicht, das immer älter ist als das Licht, und sie zu Tränen rührt.
Abgenutzte Sandalen, bittere Tränen unter dem Portikus und ein umgedrehtes Kreuz sind das kostbare Erbe des Nachfolgers des Petrus und all derer, die das Schweigen der Fische lieben.
observador





