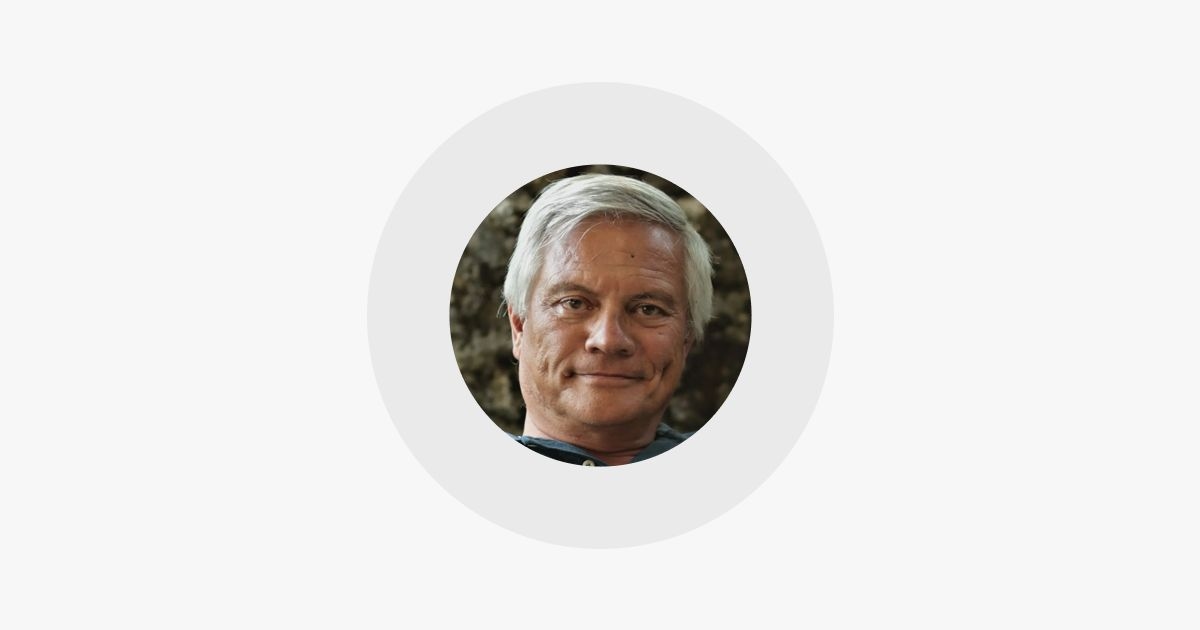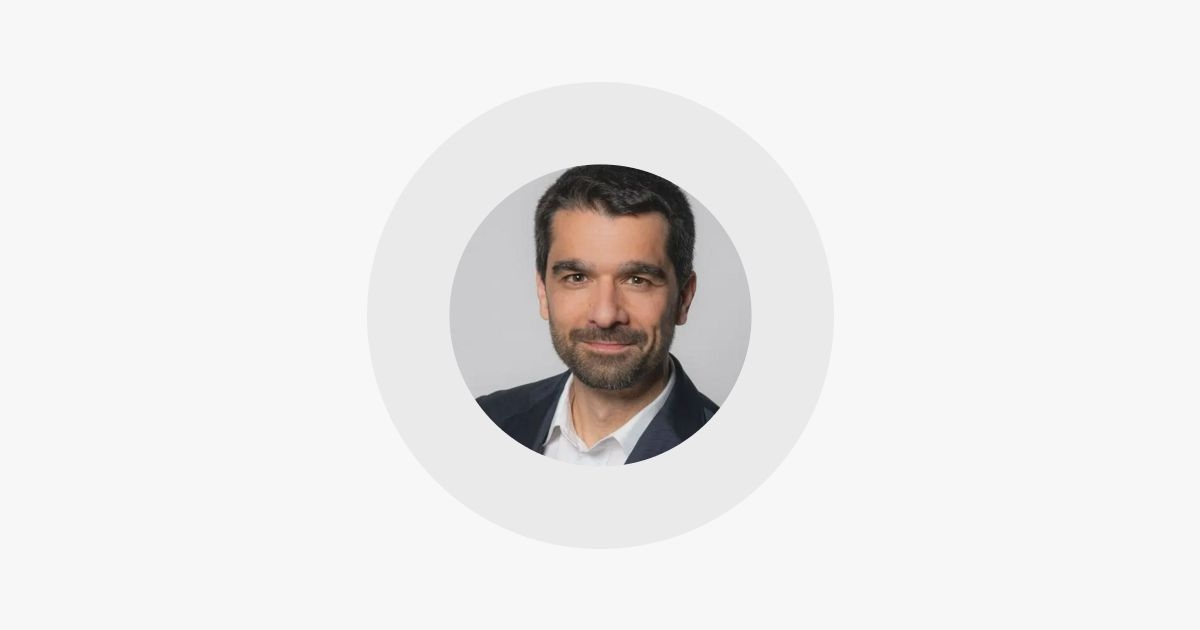Liberalismus: die vergessene Tradition
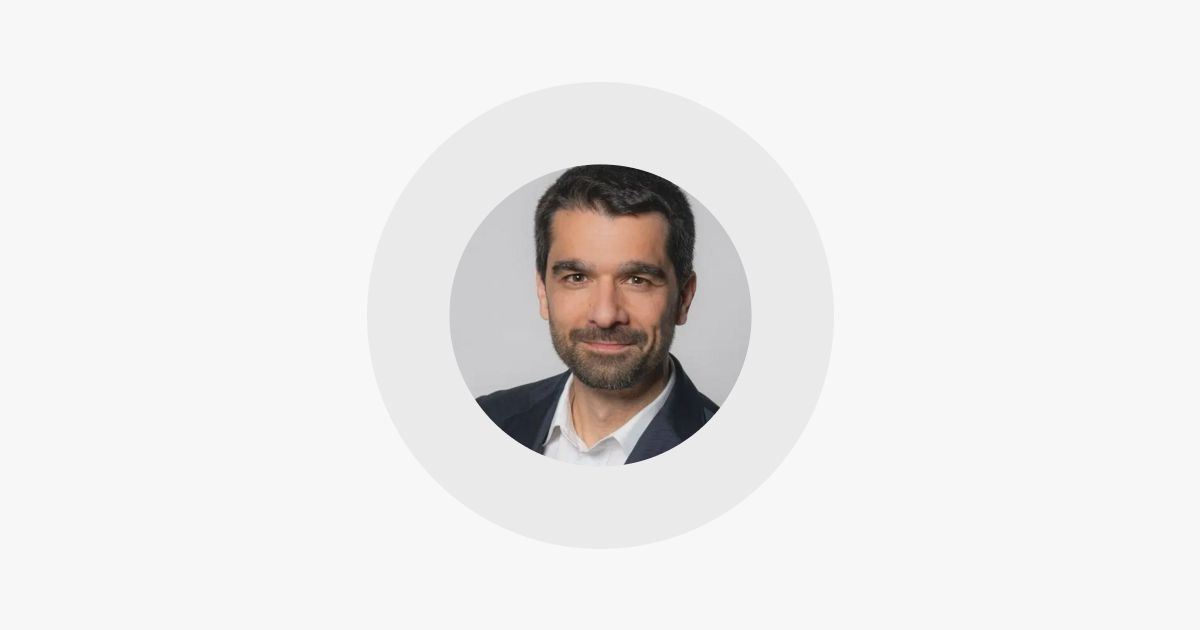
In seinem Artikel „Liberalismus in der Krise “, der in Observador veröffentlicht wurde, erinnert Miguel Morgado daran, dass der Liberalismus die transformativste intellektuelle Kraft im Westen war, die Gesellschaften und Werte so lange umgestaltete, bis er zur gemeinsamen Grammatik der demokratischen Politik wurde – sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite.
Morgado stellt jedoch fest, dass der Liberalismus an Glanz verloren hat und auf dem Rückzug ist. Seiner Ansicht nach resultiert dies im Wesentlichen aus dem zentralen Dogma des Liberalismus: der absoluten Souveränität des Individuums über sich selbst.
Mir scheint nicht, dass dies der „blinde Fleck“ des modernen Liberalismus ist.
Im Gegensatz zum Sozialismus oder Konservatismus, die eher sozialistische bzw. gemeinschaftsorientierte Philosophien darstellen und sich daher stärker mit kollektiven Belangen befassen, schlägt der Liberalismus eine Erweiterung des individuellen Autonomiegrades vor.
Liberale verstehen in ihrem Gesellschaftsmodell Konzepte wie Volk, Gemeinschaft, Nation, Gesellschaft, Tradition, Kultur oder Klassen als emergente Realitäten – geformt durch Millionen individueller Interaktionen, Institutionen und von unten nach oben generierte Verhaltensweisen – und dass sie keiner bewussten politischen Steuerung unterliegen sollten.
In der Praxis manifestieren sich diese Konzepte in Netzwerken, Institutionen und Organisationen. Diese haben einen kollektiven Charakter, der sich vom Kollektivismus unterscheidet und eine „soziale“ Sprache erfordert. Der Liberalismus hat sich mit dieser Sprache nie wohlgefühlt, und diese Einschränkung hat ihre Anwendung in diesen Bereichen behindert.
Diese Leere wurde genau von jenen ausgenutzt, die über eine stärker auf soziale Belange ausgerichtete Sprache verfügten. Von Konservativen, die von Brüderlichkeit, Gemeinschaft und Tradition sprachen. Vor allem aber von Sozialisten, die Solidarität, Gesellschaft und Fortschritt betonten. Liberale, die ersten Verteidiger der Zivilgesellschaft, waren von diesen Räumen des Austauschs und der Macht ausgeschlossen.
Im Laufe der Zeit und mit zunehmender Distanz haben Liberale das Einfühlungsvermögen für Zugehörigkeitsgefühle – zu einer gemeinsamen Klasse, Gemeinschaft oder Kultur – verloren.
Moderne Liberale haben es nicht verstanden, diese Dynamiken öffentlicher Macht zu begreifen. Sie sind in einer individualistischen Rhetorik verharrt, die von ihren Gegnern bald als „Atomismus“ bezeichnet wurde.
Das wirklich Tragische daran ist, dass das Gemeinschaftsleben für viele liberale Denker – insbesondere für die Giganten der liberalen Tradition – Gegenstand tiefgreifender Überlegungen war.
Locke formulierte die Theorie des Gesellschaftsvertrags neu und schlug vor, dass Individuen den Naturzustand verlassen, um eine Gemeinschaft (ein Gemeinwesen) zu bilden, die die individuellen Rechte – Leben, Freiheit und Eigentum – schützt. Adam Smith, der üblicherweise dem liberal-ökonomischen Spektrum zugeordnet wird, verfasste seine „Theorie der ethischen Gefühle“ siebzehn Jahre vor „Der Wohlstand der Nationen“ und erklärte darin, wie das soziale und moralische Leben der ökonomischen Logik vorausgeht.
Aus liberal-konservativer Sicht argumentierte Burke, dass Freiheit nur durch vermittelnde Institutionen – Traditionen, Gebräuche und soziale Strukturen – aufrechterhalten wird, die dem Gemeinschaftsleben Kontinuität und Sinn verleihen. Aus sozialliberaler Perspektive zeigte John Stuart Mill, dass individuelle Freiheit in einem Umfeld der Vielfalt gedeiht und dass die Gesellschaft dann aufblüht, wenn sie Andersartigkeit vor Konformität schützt.
Für Hayek ist es die Zivilgesellschaft, die durch ihre Normen und Institutionen das verstreute Wissen organisiert, ohne das individuelle Freiheit nicht existieren kann.
Diese Ansätze gehören zur liberalen Tradition – wurden aber weitgehend aufgegeben.
Das Unvermögen, diese Machtstrukturen zu verstehen – an denen der Staat nicht beteiligt ist – führte letztendlich dazu, dass sich die Liberalen von den Menschen und ihren Bedürfnissen, Ängsten, Ambitionen, Hoffnungen und menschlichen Erfahrungen entfremdeten.
Diese Abkopplung vom Menschlichen hat sich oft in einem „neoliberalen“ Diskurs niedergeschlagen – technokratisch, auf Besteuerung, Buchhaltung und Statistik fokussiert –, in dem die Sprache der Leidenschaft für Freiheit der Sprache des Managements gewichen ist, die alles andere als inspirierend ist.
Um es noch einmal zu betonen: Der Grund für den teilweisen Glanzverlust des Liberalismus liegt nicht in der Verteidigung der individuellen Souveränität, sondern vielmehr in seiner Reduzierung auf einen intellektuellen Individualismus, der von den Lebensrealitäten der Menschen losgelöst ist.
Daher gibt es keine Möglichkeit, auf die Kultur einzuwirken, die Debatte zu beeinflussen und sich effektiv an der Machtausübung zu beteiligen.
Die gute Nachricht ist, dass liberale Ideen nach wie vor die wirksamsten sind, um den menschlichen Geist zu befreien.
Für Liberale ist es notwendig, ihre leuchtende Tradition der Erforschung der menschlichen Natur, der Art und Weise, wie Menschen leben, der sozialen Phänomene – und der Anerkennung der sozialen Wunder, die von freien Menschen geschaffen und erlebt werden – wiederzuentdecken.
Liberale sollten sich dafür einsetzen, dass die Werte des gemeinsamen Erlebens menschlicher Erfahrungen – die leider von Konservativen und Sozialisten vereinnahmt wurden – durch liberale Energie, Kreativität und Hoffnung neu belebt werden.
Liberale müssen wieder von Gemeinschaft und Ordnung, von Gesellschaft und Ausgrenzung, von Möglichkeiten und Chancen, von kompromissloser Mäßigung angesichts von Intoleranz und vom Gemeinwohl, das durch Freiheit erhalten wird, sprechen.
Mit Fantasie, Inspiration und Ehrgeiz. Mit verantwortungsvoller Rebellion. Mit Verführung. Mit Gefahr.
Und mit den Menschen.
Die Wiederbelebung dieser Tradition ist unerlässlich für eine Gesellschaft, die mehr Freiheit braucht.
observador